Menü

Promotion
Der Raum der documenta
Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des Szenografischen der politischen und gesell-
schaftlichen Öffnung der Kunstausstellung am Beispiel der documenta 1987 und 2002
Die szenografische und architektonische Verbindung zwischen der Ausstellung und dem verfügbaren
Raum der Stadt Kassel, ist signifikanter Bestandteil der Ausstellungsreihe documenta. Um sich der
wechselnden Ausstellungsgestaltung der documenta adäquat zu nähern, wird ein raumbezogenes
Begriffsmodell konzipiert und zur Anwendung gebracht. Die Reduktion auf den Raum an sich
gestattet – auf Grundlage von inter- und transdisziplinären Raumtheorien und -termini – eine bisher
fehlende kunstwissenschaftliche Raumdefinition und interpretiert den aus dem Theater entlehnten
Begriff ‚Szenografie‘ für die Kunstwissenschaft. Innerhalb des herausgearbeiteten raumbezogenen
Begriffsmodells wird der euklidisch-empirische Raum als Gebäudebestand, also als Bauwerk oder
Areal (individuell) wahrnehmbar und zugleich messbar definiert. Dieser Raum ist nicht
indeterminiert: Ausstellungsgestaltungen reagieren primär auf die Strukturen des euklidisch-
empirischen Raums. Auf dessen Grundlage entsteht der produzierte Raum, der als zweidimensionale
(orthogonale) Projektion, also als Gebäudegrundriss geplant und durch Ausstellungsarchitektur
eingebracht wird. In der Folge werdenräumliche Eigenschaften transdisziplinär zur Konkretisierung
der Gestaltung von Ausstellungen für die Kunstwissenschaft benennbar. Eingedenk dessen kann der
Raum als architektonische, soziologische, philosophische sowie psychologische Entität, die diffizilen
Wechselwirkungen zwischen Atmosphären, Individuen und Objekten in Kunstausstellungen
eingrenzen und charakterisieren.
Jede documenta-Ausstellung ist zudem innerhalb einer variablen kuratorischen Hypothese ver-
woben. Folglich bedarf es einer weitergehenden Methode zur Quantifikation der Szenografie der
Ausstellungsreihe außerhalb künstlerisch-selbstreferentieller Parameter. Dies findet in den
jeweiligen Ausstellungsarchitekturen seinen Ausdruck. Manfred Schneckenburger und Okwui
Enwezor öffnen 1987 und 2002 den Kontext ihrer Ausstellungen: die ausgestellten Künstler*innen
argumentieren innerhalb eines außerreferentiellen, gesellschaftsbezogenen, zumeist politischen
Gesamtkonzeptes. Zudem verdichten die Kurator*innen ihr Konzept in der Zusammenarbeit mit
Ausstellungsarchitekt*innen innerhalb der Ausstellungsarchitektur ihrer documenta-Ausstellungen.
Seit 1955 bietet das Museum Fridericianum den euklidisch-empirischen Raum der documenta. Der
1954 wieder aufgebaute Raum der documenta 1955 bietet sich als ungenutzter Rohbau für die
Ausstellung an. Von der Auflösung konkreter künstlerischer Kennzeichen sowie dem Ge-samtausbau
des traditionellen euklidisch-empirischen Raums geprägt, wird durch Manfred Schneckenburgers
documenta 8 1987 eine ausstellungsarchitektonische Auseinandersetzung mit dem Museumkonzept
an sich angestrebt: Die documenta als Prototyp gegenwärtiger Kunst-ausstellungen wird in
Opposition zum Museum gestellt und konkretisiert innerhalb der Ausstel-lungsarchitektur eine aus
Sicht des Architekten Vladimir Lalo Nikolić adäquate Präsentationsform zeitgenössischer Kunst. Im
Sinne einer postkolonialen Ausrichtung greift die Documenta11 2002 schließlich die Thesen von
Catherine Davids documenta X 1997 auf und überführt die documenta in eine über die Ausstellung
in Kassel hinausreichende, fünfteilige Veranstaltung. Durch eine transparente Recherche macht
Enwezor seine Idee einer documenta zu Beginn des 21. Jahrhunderts dem Publikum zugänglich.
2002 wird das periphere leerstehende Industrieareal der Binding-Brauerei zum Zentrum der
Documenta11. Innerhalb dieser Architektur, welche alle Beteiligten der Ausstellung –
Kurator*innen, Künstler*innen, Besucher*innen – impliziert, überführen die Architekt*innen
KuehnMalvezzi das Ausstellungsgebäude der Binding-Brauerei in ein dynamischesPrinzip offener
Handlungsräume.
Das dreiteilige Begriffsmodell schafft am Beispiel der beiden spezifischen Ausstellungen die
Möglichkeit einer prinzipiellen, kunstwissenschaftlichen Charakterisierung der Ausstellungsge-
staltung. Prämisse dessen ist gleichwohl die konstitutive Integration des vorgefundenen Raums
einer Ausstellung durch die Ausstellungsmachenden. Wird der euklidisch-empirische Raum allein als
unkonkrete Hülle und ohne inhaltlichen Bezug einer Kunstpräsentation verstanden, ist eine
Betrachtung und Konkretion dessen, wie sie durch das raumbezogene Begriffsmodell ermöglicht
wird, weniger geeignet.
Veröffentlichung:
Großpietsch, Simon, Der Raum der documenta. Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des
Szenografischen der politischen und gesellschaftlichen Öffnung der Kunstausstellung am Beispiel
der documenta 1987 und 2002, Kassel 2020.
ISBN: 978-3-7376-0802-2
Kartoniert, Paperback, DIN A4, 336 Seiten, 217 s/w Abbildungen.
Inhaltsverzeichnis
Modell des Erdgeschosses des Museum Fridericianum mit der Ausstellungsarchitektur der documenta 8.
Modell und Foto: Simon Großpietsch.

Ein Geh- und Fußwege-Schild der Documenta11 mit Verweis
auf die Bindung-Brauerei sowie das Orientierungsschild aus
der Binding-Brauerei mit der zweidimensionalen
(orthogonalen) Projektion des Ausstellungsgebäudes in
Pergamin im Privatarchiv. Foto: Simon Großpietsch.
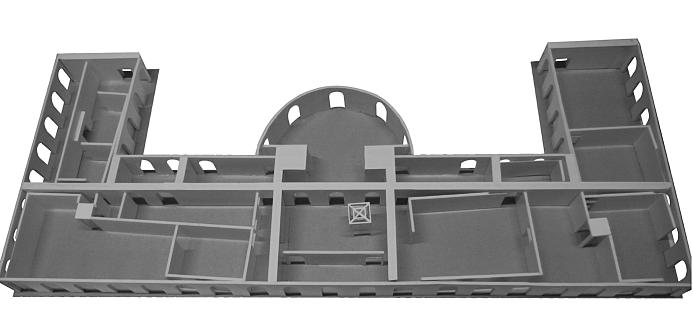

Modell des Erdgeschosses des Museum Fridericianum
mit der Ausstellungsarchitektur der documenta 8.
Modell und Foto: Simon Großpietsch.
Ein Geh- und Fußwege-Schild der Documenta11 mit
Verweis auf die Bindung-Brauerei sowie das
Orientierungsschild aus der Binding-Brauerei mit
der zweidimensionalen (orthogonalen) Projektion
des Ausstellungsgebäudes in Pergamin im
Privatarchiv. Foto: Simon Großpietsch.

Promotion
Der Raum der documenta.
Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des
Szenografischen der politischen und ge-
sellschaftlichen Öffnung der Kunstausstellung
am Beispiel der documenta 1987 und 2002
Die szenografische und architektonische
Verbindung zwischen der Ausstellung und dem
verfügbaren Raum der Stadt Kassel, ist
signifikanter Bestandteil der Ausstellungreihe
documenta. Um sich der wechselnden Ausstel-
lungsgestaltung der documenta adäquat zu
nähern, wird ein raumbezogenes Begriffsmodell
konzipiert und zur Anwendung gebracht. Die
Reduktion auf den Raum an sich gestattet – auf
Grundlage von inter- und transdisziplinären
Raumtheorien und -termini – eine bisher
fehlende kunstwissenschaftliche Raumdefinition
und interpretiert den aus dem Theater
entlehnten Begriff ‚Szenografie‘ für die
Kunstwissenschaft.
Innerhalb des herausgearbeiteten
raumbezogenen Begriffsmodells wird der
euklidisch-empirische Raum als
Gebäudebestand, also als Bauwerk oder Areal
(individuell) wahrnehmbar und zugleich
messbar definiert. Dieser Raum ist nicht
indeterminiert: Ausstellungsgestaltungen
reagieren primär auf die Strukturen des
euklidisch-empirischen Raums. Auf dessen
Grundlage entsteht der produzierte Raum, der
als zweidimensionale (orthogonale) Projektion,
also als Gebäudegrundriss geplant und durch
Ausstellungsarchitektur eingebracht wird. In
der Folge werden räumliche Eigenschaften
transdisziplinär zur Konkretisierung der
Gestaltung von Ausstellungen für die
Kunstwissenschaft benennbar. Eingedenk
dessen kann der Raum als architektonische,
soziologische, philosophische sowie
psychologische Entität, die diffizilen
Wechselwirkungen zwischen Atmosphären,
Individuen und Objekten in Kunstausstellungen
eingrenzen und charakterisieren.
Jede documenta-Ausstellung ist zudem
innerhalb einer variablen kuratorischen
Hypothese verwoben. Folglich bedarf es einer
weitergehenden Methode zur Quantifikation
der Szenografie der Ausstellungsreihe
außerhalb künstlerisch-selbstreferentieller
Parameter. Dies findet in den jeweiligen
Ausstellungsarchitekturen seinen Ausdruck.
Manfred Schneckenburger und Okwui Enwezor
öffnen 1987 und 2002 den Kontext ihrer
Ausstellun-gen: die ausgestellten
Künstler*innen argu-mentieren innerhalb eines
außerreferentiellen, gesellschaftsbezogenen,
zumeist politischen Gesamtkonzeptes. Zudem
verdichten die Kurator*innen ihr Konzept in der
Zusammenarbeit mit
Ausstellungsarchitekt*innen innerhalb der
Ausstellungsarchitektur ihrer documenta-
Ausstellungen.
Seit 1955 bietet das Museum Fridericianum den
euklidisch-empirischen Raum der documenta.
Der 1954 wieder aufgebaute Raum der
documenta 1955 bietet sich als ungenutzter
Rohbau für die Ausstellung an. Von der
Auflösung konkreter künstlerischer Kennzeichen
sowie dem Gesamtausbau des traditionellen
euklidisch-empirischen Raums geprägt, wird
durch Manfred Schneckenburgers documenta 8
1987 eine ausstellungsarchitektonische
Auseinandersetzung mit dem Museumkonzept
an sich angestrebt: Die documenta als Prototyp
gegenwärtiger Kunstausstellungen wird in
Opposition zum Museum gestellt und
konkretisiert innerhalb der
Ausstellungsarchitektur eine aus Sicht des
Architekten Vladimir Lalo Nikolić adäquate
Präsentationsform zeitgenössischer Kunst. Im
Sinne einer postkolonialen Ausrichtung greift
die Documenta11 2002 schließlich die Thesen
von Catherine Davids documenta X 1997 auf
und überführt die documenta in eine über die
Ausstellung in Kassel hinausreichende,
fünfteilige Veranstaltung. Durch eine
transparente Recherche macht Enwezor seine
Idee einer documenta zu Beginn des 21.
Jahrhunderts dem Publikum zugänglich. 2002
wird das periphere leerstehende Industrieareal
der Binding-Brauerei zum Zentrum der
Documenta11. Innerhalb dieser Architektur,
welche alle Beteiligten der Ausstellung –
Kurator*innen, Künstler*innen, Besucher*innen
– impliziert, überführen die Architekt*innen
KuehnMalvezzi das Ausstellungsge-bäude der
Binding-Brauerei in ein dynamisches Prinzip
offener Handlungsräume.
Das dreiteilige Begriffsmodell schafft am
Beispiel der beiden spezifischen Ausstellungen
die Möglichkeit einer prinzipiellen,
kunstwissenschaftlichen Charakterisierung der
AusstelLungsgestaltung. Prämisse dessen ist
gleichwohl die konstitutive Integration des
vorgefundenen Raums einer Ausstellung durch
die Ausstellungsmachenden. Wird der
euklidisch-empirische Raum allein als
unkonkrete Hülle und ohne inhaltlichen Bezug
einer Kunstpräsentation verstanden, ist eine
Betrachtung und Konkretion dessen, wie sie
durch das raumbezogene Begriffsmodell
ermöglicht wird, weniger geeignet.
Veröffentlichung:
Großpietsch, Simon, Der Raum der documenta.
Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des
Szenografischen der politischen und
gesellschaftlichen Öffnung der Kunstausstellung
am Beispiel der documenta 1987 und 2002,
Kassel 2020.
ISBN: 978-3-7376-0802-2
Kartoniert, Paperback, DIN A4, 336 Seiten, 217
s/w Abbildungen.
Inhaltsverzeichnis





